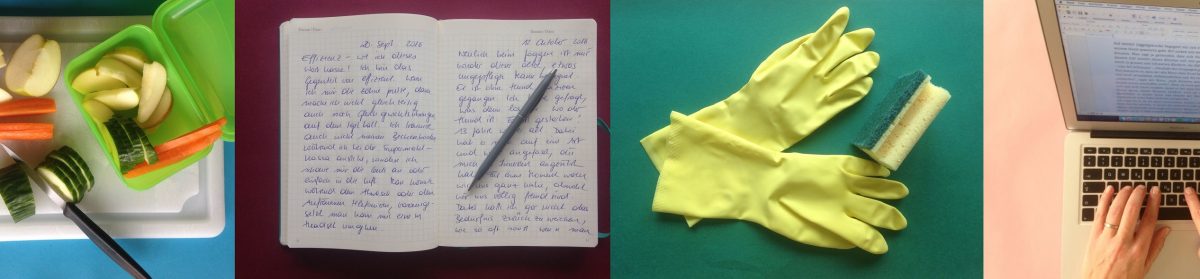Eine naive Bildbetrachtung über das Frauenbild in Rap und Pop.
Immer wieder bin ich ganz perplex, wenn auf engstem Raum komplett entgegengesetzte Gesinnungen zusammentreffen. Eigentlich ist es trivial, sich darüber zu wundern, ist es doch Communis Opinio dass eine Position alleine durch ihre Existenz das Gegenteil bedingt. Gut und böse, traditionell und innovativ, ignorant und tolerant, die Liste liesse sich noch lange fortsetzten. Klügere Köpfe als ich haben sich darüber Gedanken gemacht. Religionen wurden aus dieser kaum zu ertragenden Widersprüchlichkeit gestiftet.
Vor kurzem erlebte ich wieder so einen Moment, in der zwei Weltanschauungen, die nicht gegensätzlicher sein könnten, aufeinanderprallten und mich sprachlos zurückliessen.
Während ich auf meine Bestellung in einem Takeaway wartete, verfolgte ich das Programm von MTV im Fernseher über der Theke. Es lief ein Video von einem Rapper, der permanent seine Hoden hielt, als würden sie ihm sonst abfallen. Die Hände formte er zu Zeichen, die Insider sicherlich entschlüsseln können, ich hingegen nicht. Auch den Text verstand ich nicht, aber die Bildsprache war eindeutig. Das Gesicht des Rappers zwischen wackelnden Frauenärschen in Grossaufnahme. Ein völlig grotesker Anblick. Dann Schnitt und in der nächsten Einstellung tanzt ein anderer Rapper auf einem Sportwagen. Mehr Frauenpopos mit Beinen in Lackstiefel und flatternde Geldscheine. Alte Klischees, wir kennen das. Was früher die Brüste waren sind heute scheinbar die Arschbacken.
Nächstes Musikvideo: Ein Sänger steht in einem leeren Studio vor einem Mikrofon. Er singt zwar über «girls», gemeint sind aber erwachsene Frauen. Alle paar Takte steht ein anderes «girl» mit dem Rücken zum Sänger. Sie wackelt nicht mit dem Arsch. Sie ist nicht halbnackt, sondern trägt alltagstaugliche Kleider und Schuhe. Sie wird nicht auf ihre sexuelle Attraktivität reduziert. Es geht um die ganze Frau, genauer um verschiedene Frauen. Frauen mit Kindern, ohne Kinder, lesbische Frauen, hetero Frauen, Frauen mit kurzen Haaren, mit blauen Augen, usw. einfach um alle Frauen.
Was für ein Hohn, dass diese Hymne auf das weibliche Geschlecht im Musikprogramm von MTV ausgerechnet auf ein sexistisches, misogynes Musikvideo folgt.
Dieses Ereignis beschäftigt mich jetzt seit Wochen. Es hat lange gedauert, bis ich den Titel (Zeze) und den Künstler (Kodak Black) des betreffenden Rap-Songs ausfindig gemacht habe. Ich schaue mir das Video noch mal mit meinem 14-jährigen Sohn an. Schon im Vorspann lacht er laut los. Ich frage ihn, was er so lustig findet und er erklärt mir, dass der eine Sänger gerade gesagt habe, er hätte gerne «ass» im Video, während sein Kompagnon lieber einen «Demon» (ein Sportauto) möchte. In das Video eingebaut sind auch verschiedene «making of» Szenen. Mein Sohn findet es amüsant. «Kein Grund sich so aufzuregen, Mama», sagt er. Aber ich rege mich auf. Sehr sogar. Ich finde das Video äusserst geschmacklos und frauenverachtend. Während wir diskutieren erinnere ich mich an eine ähnliche Kontroverse mit ihm vor einem Jahr. Damals ging es um die Textpassage «Mein Körper definierter als von Ausschwitzinsassen» in einem Song von Kollegah und Farid Bang. Während mir der Mund offen stehen blieb angesichts so einer Geschmacklosigkeit, fand mein Sohn die Sache halb so wild. Nicht weil er den Nationalsozialismus verharmlosen würde oder nicht weiss, was sich in Ausschwitz zugetragen hat, sondern weil er findet, dass beim Rap andere Regeln gelten.
Mag sein, dass die Regeln des Rap sich einer 47-jährigen Hausfrau nicht erschliessen, mag sein, dass Rap absichtlich mit Grenzüberschreitungen provozieren will, sei es mit geschmacklosen und unangebrachten Holocaust Vergleichen oder mit einem sexistischen Frauenbild. Ich finde es trotzdem abstossend und menschenverachtend.
Genauso wie «Zeze» von Kodak Black und «Girls like me» von Maroon 5 in den USA Charts zu Beginn des Jahres 2019 nur wenige Plätze voneinander entfernt lagen, hatte übrigens auch «0815» von Kollegah und Farid Bang 2018 eine Antipode, nämlich das Remix des alten italienischen Partisanenliedes «Bella ciao» von HUGEL. Wie oft wurden diese beiden Hits wohl direkt nacheinander abgespielt? Und waren sich die Hörer*innen eigentlich dieser Ironie bewusst?