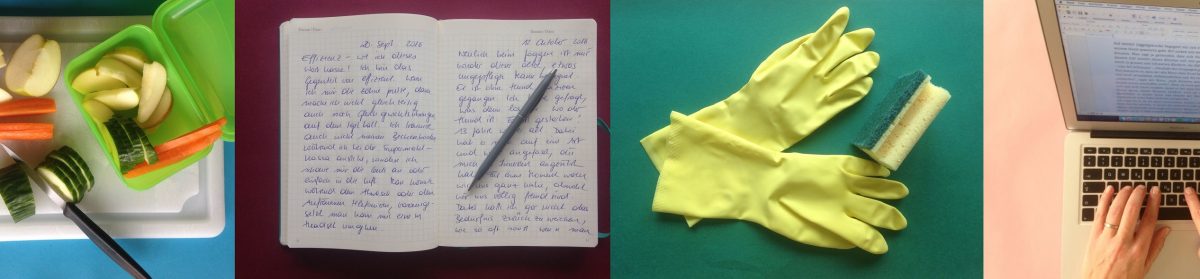So traf sie ihn also wieder nach fünfundzwanzig Jahren. Sie hatte ihn schon gesehen, er hatte es nicht bemerkt. Aber sie wollte von ihm gesehen werden. Darum setzte sie sich an einen Tisch und wartete, bis er zu ihr kam. Sie wusste eigentlich nicht so genau, warum sie ihn unbedingt wieder treffen wollte. Sie waren ein paar Monate gemeinsam durchs Leben gegangen, nein, eher gestolpert und schliesslich auf die Nase gefallen. Sie hatte kaum Erinnerungen an diese kurze gemeinsame Zeit. Nur ein diffuses Gefühl. Etwas war schief gegangen. Erwartungen wurden nicht erfüllt. Die Kommunikation stimmte nicht. Und doch waren da kurze Episoden, die wie im Schlaglicht aufblitzen: er spielte Gitarre und sang für sie; sie an seiner Hand in einem Ballsaal. Und dann diese unglückselige Nacht in einem abgelegenen Haus in den Bergen. Die Worte, die er ihr in seiner Frustration an den Kopf warf, lassen sie heute noch zusammenzucken. Sie glaubt sich zu erinnern, dass sie mitten in der Nacht überstürzt aufbrach.
Diese Szene hatte sie vor Augen, als sie ihm nach all den Jahren, in denen sie geheiratet und zwei Kinder gross gezogen hatte, in einem Café am See gegenüber sass. Sie trug Sonnenbrillen, weil sie neuerdings empfindlich auf helles Licht reagierte. Aber auch, weil sie nicht zu viel von sich preisgeben wollte. Sie sah in seinem Gesicht den jungen Mann von damals, in den sie sich verliebt hatte; sah seinen aufmüpfigen, herausfordernden Gesichtsausdruck, an den sie sich gut erinnerte und die funkelnden Augen. Das Lächeln, das gleichzeitig warmherzig und spöttisch war.
Er erzählte, wie es ihm ergangen war in den vergangenen Jahren. Gab ihr keine Möglichkeit einzuhaken. Berichtete über die Prüfungen und Schicksalsschläge seines Lebens als wären es Stationen eines Postenlaufes, die es abzuhaken galt. Kein Wort glaubt sie ihm, wenn er sagt, das sei alles nicht so schlimm gewesen. Zu gut erinnert sie sich daran, wie er schon damals jede Unsicherheit überspielt hat. Er schützte seine Seele so wie sie ihre Augen schützte, die vielleicht ihre Sehnsucht verraten hätten.
Der Abschied fiel ihr schwer. Die Wörter waren ihnen ausgegangen und doch war gar nichts gesagt. Die fehlenden Worte fand sie in der Umarmung, die sie von ihm erbat. In diesen wenigen Sekunden, in denen sie sich in dieser unschuldigsten aller Berührungen begegneten, lag so vieles. Vergebung, Trost aber auch eine Sehnsucht. Sie wussten beide, sie würden das Versäumte nie nachholen können.
Epilog
„Fünfundzwanzig Jahre und sie vergingen dem Jaakob wie ein Traum, wie das Leben vergeht dem Lebenden in Verlangen und Erreichen, in Erwartung, Enttäuschung, Erfüllung und sich aus Tagen zusammensetzt, die er nicht zählt und von denen ein jeder nur das Seine bringt; die in Warten und Streben, in Geduld und Ungeduld einzeln zurückgelegt werden und zu grösseren Einheiten verschmelzen, zu Monaten, Jahren und Jahresgruppen, von denen am Ende eine jede ist wie ein Tag.“ Thomas Mann, Joseph und seine Brüder. Die Geschichten Jaakobs (Fischer, Frankfurt am Main 19998 Seite244)